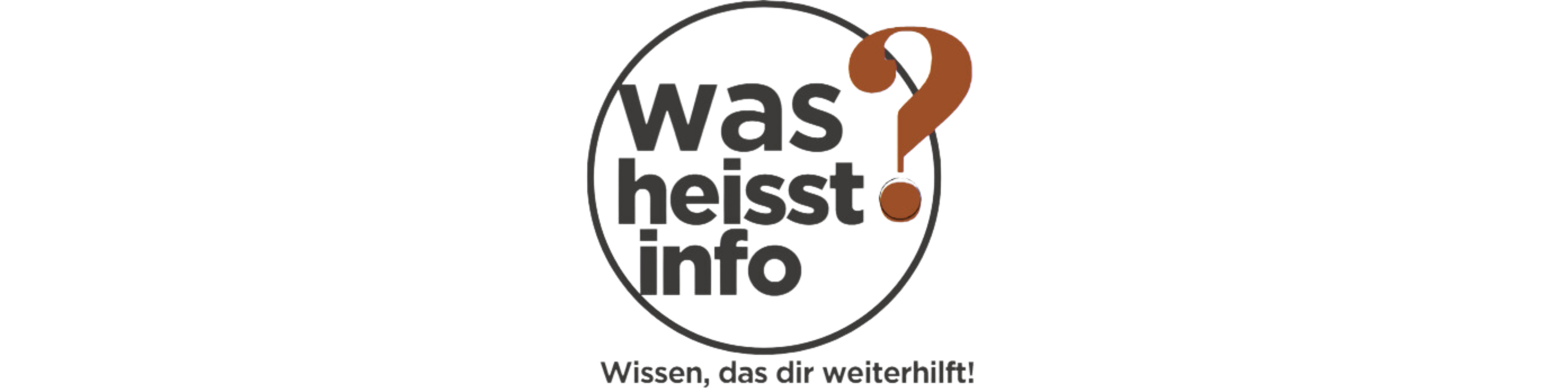PTBS, kurz für posttraumatische Belastungsstörung, ist eine psychische Krankheit. Sie entsteht oft nach einem sehr starken Ereignis. Ereignisse wie große Gefahren oder Katastrophen können dazu führen.
Die Begriffe PTBS, posttraumatisches Belastungssyndrom und posttraumatisches Stresssyndrom sind gleichbedeutend. Sie werden oft synonym verwendet.
Im Laufe ihres Lebens erleben viele Menschen ein traumatisches Ereignis. Die Wahrscheinlichkeit, nach einem solchen Ereignis an PTBS zu erkranken, hängt von dem Trauma ab. Besonders nach Vergewaltigungen, Gewaltverbrechen und Kriegstraumata ist das Risiko hoch.
Naturkatastrophen, Brände, Unfälle oder akute Krankheiten können auch PTBS auslösen. Doch das Risiko ist hier niedriger als bei Verletzungen durch Menschen.
Etwa 10% der Menschen, die ein Trauma erlebt haben, entwickeln PTBS. Weltweit beträgt das Risiko im Laufe des Lebens für PTBS etwa 8%. Was bedeutet PTBS genau und wie wirkt sich die Diagnose auf Betroffene aus?
Wichtige Erkenntnisse
- PTBS steht für posttraumatische Belastungsstörung und ist eine psychische Erkrankung nach extrem belastenden Ereignissen
- Über 50% der Menschen erleben mindestens einmal im Leben ein traumatisches Ereignis
- Etwa 10% der von einem Trauma Betroffenen entwickeln eine PTBS
- Das Risiko für eine PTBS hängt von der Art des Traumas ab und ist nach zwischenmenschlicher Gewalt am höchsten
- Weltweit liegt die Lebenszeitprävalenz für PTBS bei ca. 8%
Definition von PTBS
PTBS, kurz für Posttraumatische Belastungsstörung, ist eine psychische Krankheit. Sie entsteht nach einem schweren Trauma. Menschen mit PTBS erleben das Trauma als lebensbedrohlich.
Die Symptome können das Leben stark beeinflussen. Sie machen den Alltag schwerer.
Was ist eine posttraumatische Belastungsstörung?
PTBS ist eine Reaktion auf ein großes Trauma. Typische Symptome sind:
- Wiedererleben des Traumas in Erinnerungen oder Albträumen
- Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind
- Negative Veränderungen in Gedanken und Stimmung
- Erhöhte Erregbarkeit und Schreckhaftigkeit
Nur ein Teil der Menschen entwickelt PTBS nach einem Trauma. Die Statistiken zeigen:
| Gruppe | Häufigkeit der PTBS-Entwicklung |
|---|---|
| Erwachsene mit mindestens einem Trauma | 14% (ein Fünftel von 70%) |
| Vergewaltigungsopfer mit akuter Belastungsstörung | 50% |
| Männer mit Trauma | 8% |
| Frauen mit Trauma | 20% |
Wann wird die Diagnose PTBS gestellt?
PTBS wird diagnostiziert, wenn die Symptome länger als einen Monat bestehen. Sie müssen das Leben erheblich beeinträchtigen. Oft zeigen sich die Symptome Monate oder Jahre nach dem Ereignis.
Das Ausbilden einer posttraumatischen Belastungssymptomatik ist keine Charakterschwäche, sondern eine “normale Reaktion eines normalen Menschen auf ein abnormes Ereignis”.
Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung kann helfen. Sie verringert die Dauer und Schwere der PTBS. So können Betroffene besser mit dem Trauma umgehen.
Ursachen von PTBS
Die Ursachen für posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sind vielfältig. Jeder Fall ist einzigartig. Ein traumatisches Erlebnis, das als lebensbedrohlich empfunden wird, ist oft der Auslöser.
Traumatische Ereignisse als Auslöser
Häufige Ursachen für PTBS sind:
- Gewalttaten wie körperliche Angriffe, Vergewaltigungen oder Überfälle
- Schwere Unfälle, insbesondere Verkehrsunfälle mit lebensbedrohlichen Verletzungen
- Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Wirbelstürme
- Kriegserlebnisse und Kampfeinsätze bei Soldaten
- Folter, Geiselnahmen oder politische Verfolgung
Die Schwere des Traumas ist wichtig. Studien zeigen, dass 50% der Opfer von Krieg, Vergewaltigung oder Folter PTBS entwickeln. Bei Verkehrsunfällen oder schweren Krankheiten liegt die Rate bei etwa 10%.
Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTBS
Es gibt weitere Faktoren, die das Risiko erhöhen:
- Schwere und Dauer des Traumas: Je länger und intensiver, desto höher das Risiko.
- Persönliche Vorgeschichte: Frühere traumatische Erfahrungen oder psychische Probleme können das Risiko steigern.
- Mangelnde soziale Unterstützung: Ohne ein stabiles soziales Umfeld kann das Risiko steigen.
- Biologische Faktoren: Genetische Veranlagungen und Hirnveränderungen können das Risiko beeinflussen.
Es ist wichtig zu wissen, dass nicht jeder, der ein traumatisches Erlebnis erlebt, PTBS entwickelt. Viele können nach einer Zeit wieder in den Alltag zurückkehren. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um langfristige Schäden zu verhindern.
Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zeigt sich durch viele Symptome. Diese PTBS-Symptome können unterschiedlich sein. Sie können das Leben der Betroffenen stark beeinflussen.
Wiedererlebens-Symptome
Ein Hauptmerkmal der PTBS ist das ungewollte Wiedererleben des Traumas. Dies zeigt sich in lebhaften Erinnerungen, Albträumen oder Flashbacks. Betroffene fühlen, als ob sie das Trauma erneut erleben.
Vermeidungsverhalten
Menschen mit PTBS meiden oft Situationen, die sie an das Trauma erinnern. Sie ziehen sich zurück und verlieren Interesse an Dingen, die ihnen früher Freude bereiteten. Manchmal können sie sich nicht an wichtige Teile des Traumas erinnern.
Negative Veränderungen in Gedanken und Stimmung
PTBS kann die Gedanken- und Gefühlswelt verändern. Betroffene können sich schlecht fühlen und sich von anderen abgestoßen fühlen. Sie haben Schwierigkeiten, sich auf die Zukunft zu freuen.
Eine posttraumatische Belastungsstörung äußert sich in einer Vielzahl von Symptomen, darunter Übererregung mit Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Albträume, Vermeidungsverhalten, Abgestumpftheit, Verlust von Interessen und Einschränkungen der Gefühlswelt.
Übererregung
Ein weiteres Zeichen der PTBS ist ständige Übererregung. Betroffene sind leicht reizbar und haben Schwierigkeiten, sich zu entspannen. Sie leiden unter Schlafstörungen und Konzentrationsproblemen.
| Symptomgruppe | Häufige Anzeichen |
|---|---|
| Wiedererleben | Flashbacks, Albträume, lebhafte Erinnerungen |
| Vermeidung | Rückzug, Interessenverlust, emotionale Taubheit |
| Negative Veränderungen | Schuldgefühle, vermindertes Selbstwertgefühl, Entfremdung |
| Übererregung | Reizbarkeit, Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme |
Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, unter PTBS-Anzeichen leidet, ist professionelle Hilfe wichtig. Frühe Diagnose und Behandlung können helfen, die Symptome zu mindern und das Leben zu verbessern.
Auswirkungen von PTBS auf das tägliche Leben
Eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) kann das Leben stark beeinflussen. Symptome wie Wiedererlebens-Symptome und Vermeidungsverhalten stören oft den Alltag. Auch negative Veränderungen in Gedanken und Stimmung sowie Übererregung sind typisch.
Viele mit PTBS ziehen sich zurück. Sie meiden Orte, die sie an den Traum erinnern. Das führt oft dazu, dass sie wichtige Termine verpassen und sich isolieren.
Die ständige Spannung macht es schwer, Beziehungen zu bauen oder zu halten. Im Beruf kann PTBS ebenfalls Probleme verursachen. Konzentrationsschwierigkeiten und emotionale Ausbrüche beeinträchtigen die Leistung.
“Die PTBS hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich konnte meinen Alltag nicht mehr bewältigen und musste meine Arbeit aufgeben. Es war ein langer Weg, bis ich wieder Fuß fassen konnte.” – Betroffene, 45 Jahre
Die folgende Tabelle zeigt einige häufige Auswirkungen der PTBS auf verschiedene Lebensbereiche:
| Lebensbereich | Mögliche Auswirkungen der PTBS |
|---|---|
| Soziale Beziehungen | Rückzug, Isolation, Konflikte, Schwierigkeiten Beziehungen aufzubauen |
| Beruf | Konzentrationsschwierigkeiten, Leistungsabfall, häufige Fehlzeiten, Jobverlust |
| Familie | Spannungen, emotionale Ausbrüche, Entfremdung, Scheidung |
| Freizeit | Verlust von Interessen, Vermeidung von Aktivitäten, Rückzug |
Jeder reagiert anders auf PTBS. Individuelle Unterstützung ist wichtig. Frühe Diagnose und Behandlung können helfen, den Alltag zu verbessern.
Körperliche Folgen von PTBS
PTBS kann die Psyche stark belasten und auch körperliche Probleme verursachen. Viele Menschen mit PTBS haben körperliche Symptome, die ihr Leben schwer machen. In Mitteleuropa erleben etwa die Hälfte der Menschen ein Trauma im Leben. Rund 9 Prozent entwickeln danach PTBS.
Der Zusammenhang zwischen PTBS und Nervensystem ist noch nicht vollständig erforscht. Es gibt Hinweise, dass PTBS das Nervensystem dauerhaft übererregt. Dies führt zu Anspannung, Schreckhaftigkeit und einem Gefühl ständiger Bedrohung. Betroffene haben oft Muskelverspannungen, Zittern, Schweißausbrüche, Herzklopfen und Schmerzen.
Auswirkungen auf das Nervensystem
Die vegetative Übererregbarkeit bei PTBS führt zu verschiedenen Symptomen im Nervensystem. Dazu gehören:
- Reizbarkeit und Nervosität
- Impulsivität
- Schlafstörungen
- Konzentrationsstörungen
Diese Symptome können den Alltag stark beeinträchtigen. Sie erschweren es den Betroffenen, mit Stress umzugehen.
Erhöhtes Risiko für andere Erkrankungen
PTBS kann auch das Risiko für andere Krankheiten erhöhen. Studien zeigen, dass Menschen mit PTBS häufiger unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Problemen und chronischen Schmerzsyndromen leiden.
| Erkrankung | Erhöhtes Risiko bei PTBS |
|---|---|
| Herz-Kreislauf-Erkrankungen | 30-50% |
| Magen-Darm-Probleme | 20-40% |
| Chronische Schmerzsyndrome | 30-60% |
Eine frühzeitige Behandlung kann das Risiko für diese Krankheiten senken. Betroffene sollten professionelle Hilfe suchen, um die Symptome zu lindern und langfristige Gesundheitsprobleme zu vermeiden.
Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung
Die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) braucht viel Sorgfalt und Empathie. Es ist wichtig, früh zu erkennen, um schnell zu helfen. Gespräche mit Experten und spezielle Fragebögen sind dabei sehr hilfreich.

Diagnosegespräch mit Ärztin oder Psychotherapeut
Ein Gespräch mit einem Fachmann ist der erste Schritt. Dabei werden Symptome und Lebensumstände besprochen. Ein vertrauensvolles Umfeld ist wichtig, damit der Betroffene offen sein kann.
Selbstbeurteilungs-Fragebögen
Neben dem Gespräch nutzen Experten Fragebögen. Diese helfen, die Symptome genau zu erfassen. Zum Beispiel die PCL oder IES Fragebögen. So können sie die Belastung besser einschätzen.
Differentialdiagnosen
Bei der Diagnose muss man auch andere Erkrankungen bedenken. Zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen. Eine genaue Unterscheidung ist wichtig, um die richtige Behandlung zu finden.
| Diagnoseinstrument | Beschreibung |
|---|---|
| Klinisches Interview | Ausführliches Gespräch mit Ärztin, Arzt oder Psychotherapeut zur Erfassung der Symptome und Lebensumstände |
| Selbstbeurteilungs-Fragebögen | Standardisierte Fragebögen wie PCL oder IES zur systematischen Erfassung der PTBS-Symptome |
| Strukturierte diagnostische Interviews | Spezielle Interviews wie SKID zur Abgrenzung von PTBS gegenüber anderen psychischen Störungen |
Eine genaue Diagnose ist wichtig, um früh zu helfen. Gespräche, Fragebögen und Interviews helfen dabei. So können Experten PTBS zuverlässig diagnostizieren und die beste Behandlung finden.
Behandlungsmöglichkeiten bei PTBS
Die Behandlung von PTBS braucht einen ganzheitlichen Ansatz. Dieser umfasst psychotherapeutische und medikamentöse Maßnahmen. Das Ziel ist, die Symptome zu mindern und die Lebensqualität zu steigern.
Psychotherapie
Die PTBS-Therapie nutzt verschiedene Verfahren. Zu den wirksamen Methoden gehören:
- Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)
- Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
- Prolonged Exposure Therapy (PE)
- Cognitive Processing Therapy (CPT)
- Narrative Exposure Therapy (NET)
- Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEPP)
Diese Therapien helfen, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten. Sie verändern auch dysfunktionale Denkmuster. So entwickeln Betroffene Bewältigungsstrategien.
Die richtige Therapieform hängt von den Bedürfnissen des Patienten ab. Eine gute Beziehung zwischen Therapeut und Patient ist wichtig für den Erfolg.
Medikamentöse Behandlung
Manchmal ist eine medikamentöse Behandlung nützlich. Sie hilft bei Schlafstörungen, Angstzuständen oder Depressionen. Antidepressiva der neuen Generation, wie SSRI, werden oft eingesetzt. Die Entscheidung für PTBS-Medikamente sollte immer mit einem Psychiater besprochen werden.
| Therapieform | Wirkungsweise |
|---|---|
| Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) | Veränderung dysfunktionaler Denkmuster und Entwicklung von Bewältigungsstrategien |
| Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) | Verarbeitung traumatischer Erinnerungen durch bilaterale Stimulation |
| Medikamentöse Behandlung (z.B. SSRI) | Linderung von Begleitsymptomen wie Schlafstörungen, Angstzustände oder depressive Verstimmungen |
Zusätzlich zu den Therapien können kreative Methoden helfen. Musik-, Kunst- oder Bewegungstherapie sowie Entspannungstechniken wie Yoga sind nützlich. Eine umfassende PTBS-Behandlung berücksichtigt die psychosoziale Situation des Patienten. Sie bietet Unterstützung bei beruflichen oder sozialen Problemen.
Prävention von PTBS
Um PTBS vorzubeugen, ist frühzeitige Unterstützung wichtig. Es hilft, die eigene Resilienz zu stärken. Forschungen zeigen, dass Therapien wie kognitive Verhaltenstherapie (CBT) und soziale Unterstützung helfen.
Für Risikogruppen wie Einsatzkräfte gibt es spezielle Programme. Diese fördern Psychoedukation, Selbstmanagement und soziale Unterstützung. So wird die psychische Widerstandskraft gestärkt.
| Präventionsmaßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Frühe Interventionen | Zeitnahe Unterstützung nach einem Trauma, insbesondere bei akuten Stressreaktionen |
| Kognitive Verhaltenstherapie (CBT) | Therapieansatz zur Verarbeitung des Traumas und Veränderung negativer Denkmuster |
| Soziale Unterstützung | Stabiles Umfeld und vertrauensvolle Beziehungen als Schutzfaktor |
| Resilienztraining | Stärkung der psychischen Widerstandskraft durch Selbstmanagement und Stressbewältigung |
Debriefing nach einem Trauma ist nicht wirksam. Es kann sogar schaden und Symptome verschlimmern.
Die beste Prävention ist es, die eigene Resilienz kontinuierlich zu stärken und im Ernstfall nicht zu zögern, sich Unterstützung zu suchen.
Es ist wichtig, individuell zu prüfen, welche Präventionsmaßnahmen passen. Eine Kombination aus professioneller Hilfe, sozialer Unterstützung und Selbstfürsorge hilft, PTBS zu vermeiden.
Mythen und Fakten über PTBS
Das Bewusstsein für posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) wächst. Doch Mythen und Vorurteile halten an. Es ist wichtig, diese durch Fakten zu ersetzen, um Betroffenen zu helfen und Stigmatisierungen abzubauen.

Ein Irrglaube ist, PTBS sei eine Charakterschwäche. Doch es ist eine ernstzunehmende psychische Erkrankung, die Behandlung braucht. Auch ist nicht nur Soldaten betroffen, sondern jeder nach einem traumatischen Erlebnis.
| Mythos | Fakt |
|---|---|
| PTBS ist eine Charakterschwäche | PTBS ist eine ernstzunehmende psychische Erkrankung |
| Vor allem Soldaten sind von PTBS betroffen | PTBS kann nach unterschiedlichsten Traumata auftreten |
| PTBS-Symptome verschwinden von allein | Professionelle Hilfe ist meist nötig, um Symptome zu lindern |
Ein weiteres Vorurteil ist, dass die Symptome von PTBS von alleine verschwinden. Doch Studien zeigen, dass viele Betroffene Hilfe brauchen. Eine traumaspezifische Psychotherapie kann helfen, die Lebensqualität zu verbessern.
“PTBS ist keine persönliche Schwäche oder ein Zeichen von Versagen. Es ist eine normale Reaktion auf abnormale, traumatische Ereignisse. Mit der richtigen Behandlung und Unterstützung können Betroffene lernen, die Erkrankung zu bewältigen und ihr Leben wieder selbstbestimmt zu gestalten.”
– Dr. Julia Schellong, Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie
Betroffene haben ein Recht auf Verständnis und Unterstützung. Angehörige und das Umfeld sollten sich bewusst sein, dass PTBS eine langwierige Erkrankung ist. Statt Ratschläge sind praktische Hilfe und ein offenes Ohr gefragt. Gemeinsam lässt sich die Erkrankung Schritt für Schritt bewältigen.
Unterstützung für Betroffene und Angehörige
Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und ihre Familien brauchen Unterstützung. Es gibt viele Wege, Hilfe zu finden und sich mit anderen auszutauschen.
Selbsthilfegruppen sind eine gute Möglichkeit. Dort teilen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen ihre Geschichten. Es hilft, sich nicht so allein zu fühlen.
Selbsthilfegruppen
In vielen Städten gibt es Selbsthilfegruppen für PTBS. Sie werden von Experten geleitet. Dort kann man über eigene Erlebnisse sprechen und gemeinsam entspannen.
„In der Gruppe habe ich gemerkt, dass ich mit meinen Problemen nicht alleine bin. Das hat mir Mut gemacht, mich meinen Ängsten zu stellen und an mir zu arbeiten.” – Teilnehmerin einer PTBS-Selbsthilfegruppe
Beratungsstellen
Beratungsstellen bieten auch Unterstützung. Dort arbeiten Fachleute, die helfen und informieren. Sie vermitteln auch an Therapeuten.
Für Angehörige ist professionelle Hilfe wichtig. Sie fühlen oft Hilflosigkeit und Schuld. In Beratungen lernen sie, besser mit der Situation umzugehen.
| Anlaufstelle | Angebot | Zielgruppe |
|---|---|---|
| Selbsthilfegruppen | Austausch mit anderen Betroffenen, gemeinsame Aktivitäten | PTBS-Betroffene |
| Beratungsstellen | Information, Beratung, Vermittlung von Hilfsangeboten | PTBS-Betroffene und Angehörige |
| Psychotherapeuten | Diagnose, Einzeltherapie, EMDR, Medikation | PTBS-Betroffene |
| Traumaambulanzen | Schnelle Hilfe und Behandlung nach Traumatisierung | Akut Betroffene |
Es ist wichtig, dass Betroffene und Angehörige wissen, dass sie nicht alleine sind. PTBS ist behandelbar. Es gibt viele Unterstützungsangebote, um zurück ins Leben zu finden. Der erste Schritt ist schwer, aber er lohnt sich!
PTBS bei speziellen Personengruppen
Posttraumatische Belastungsstörungen können jeden treffen. Doch einige Gruppen sind besonders gefährdet. Dazu gehören Kinder, Jugendliche und Soldaten, die schwere Erfahrungen gemacht haben.
PTBS bei Kindern und Jugendlichen
Kinder und Jugendliche sind sehr anfällig für Traumata. Ihre Symptome sehen oft anders aus als bei Erwachsenen. Sie können aggressiv sein, sich zurückziehen oder Probleme mit dem Konzentrieren haben.
Alpträume, Schlafprobleme und körperliche Beschwerden sind auch typisch. Es ist wichtig, bei Kindern und Jugendlichen schnell zu helfen.
Entwicklungsspezifische Therapien sind nötig. Spieltherapie und kreative Methoden helfen. Eltern und das soziale Umfeld sind auch wichtig für die Genesung.
PTBS bei Soldaten
Soldaten erleben oft wiederholt schwere Situationen. Kriege, Gewalt und der Verlust von Kameraden können schwerwiegende seelische Schäden verursachen. Bis zu 20% der Soldaten entwickeln nach Kriegseinsätzen PTBS.
Es gibt spezielle Programme für Soldaten. Diese beinhalten Resilienztraining und Strategien zur Stressbewältigung. Nach schweren Einsätzen ist eine enge psychologische Betreuung wichtig.
| Personengruppe | Besonderheiten | Unterstützungsmaßnahmen |
|---|---|---|
| Kinder und Jugendliche | Erhöhte Vulnerabilität, andere Symptomausprägung | Entwicklungsspezifische Therapien, Einbezug des Umfelds |
| Soldaten | Wiederholte Traumaexposition, hohe Prävalenz | Präventionsprogramme, psychologische Nachbetreuung |
“Traumatisierte Kinder und Jugendliche brauchen vor allem eins: Sicherheit und Geborgenheit. Nur so können sie die Erlebnisse verarbeiten und neues Vertrauen fassen.”
– Dr. Ulrike Behrens, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
Es ist wichtig, dass spezielle Gruppen wie Kinder, Jugendliche und Soldaten besondere Aufmerksamkeit bekommen. Nur so können wir ihnen helfen, mit ihren Erfahrungen umzugehen und eine Zukunft zu planen.
Fazit
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine ernste psychische Krankheit. Sie entsteht nach extremen Ereignissen. Etwa acht Prozent der Menschen erleben PTBS im Laufe ihres Lebens.
Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Genetische Faktoren spielen eine große Rolle bei PTBS. Bestimmte Gene erhöhen das Risiko.
Die Symptome von PTBS umfassen Wiedererleben und Vermeidungsverhalten. Auch negative Veränderungen in Gedanken und Stimmung sowie Übererregung gehören dazu.
PTBS beeinträchtigt das tägliche Leben stark. Es wirkt sich auf die psychische und körperliche Gesundheit aus. Frühe Diagnose und Behandlung sind wichtig.
Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehören Psychotherapie und Medikamente. Prävention und Früherkennung sind wichtig. So finden Betroffene schneller Hilfe.
Ein offener Umgang mit PTBS ist entscheidend. Jeder kann betroffen sein. Deshalb ist es wichtig, mehr über PTBS zu wissen.
Kinder, Jugendliche und Soldaten sind besonders gefährdet. Unterstützung durch Selbsthilfegruppen ist sehr wertvoll. Die Gesellschaft sollte mehr über PTBS erfahren.
So können wir Betroffenen helfen. Wir können ihnen ein erfülltes Leben ermöglichen.